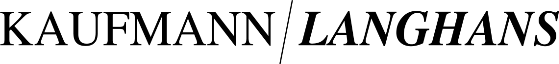Was Symbolik bei der digitalen Transformation leisten muss
Sneakers für den Vorstand sind zu wenig
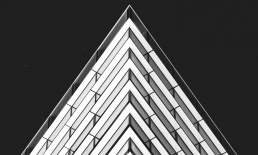
Innovation Hubs sprießen aus dem Boden, CEOs tragen weiße Sneakers und neuerdings sagt man auch in den erzkonservativsten Branchen wie selbstverständlich Du zueinander – die digitale Transformation der Konzernwelt ist überfrachtet mit der immergleichen, plumpen Symbolik. Unterscheidbarkeit oder strategische Fundierung? Fehlanzeige. Ein Jammer, bräuchte es doch gerade in unruhigen Zeiten wie diesen die Kraft klarer, starker und mobilisierender Symbole.
„Symbols are more meaningful than things themselves“, konstatiert die amerikanische Künstlerin Jenny Holzer in ihren sogenannten Truisms. Das Symbol als Realitätsersatz, eine entechtete Welt voll Schein und ohne Sein – solch eine Verrohung will so mancher Kulturpessimist immer mal wieder ausmachen, wenn gerade allzu fahrlässig mit Symbolik und durchsichtiger Bildsprache hantiert wird und dahinter nichts steht als ein kahles, unbestelltes Feld. Symbolik, häufig geschmäht als Symbolpolitik, ist in Verruf geraten – in Teilen völlig zu Recht. Sie steht heute für viel gesagt und nichts getan, für leere Worte und gebrochene Versprechen. Ein Jammer, sind es doch Symbole, die eine enorm vereinende Kraft entwickeln können, die Barrieren überwinden, Menschen mobilisieren und so den Fortschritt vorantreiben. Schon im Alltäglichen erscheint eine Gesellschaft ohne Symbole kaum denkbar: Gesten, Piktogramme oder Zeichen, sie alle sind unerlässlich, um Komplexität auf ein erträgliches Maß zu reduzieren. Ein gesellschaftlich geteiltes Verständnis etwa von einem Toilettensymbol oder einem Stoppschild macht unseren Alltag unzweifelhaft angenehmer beziehungsweise sicherer. Symbole sichern die Anschlussfähigkeit der Vielen, sie schaffen geteilte Projektionsflächen, einen Minimalkonsens. Symbolik, das ist per se etwas Gutes, etwas, das das Voranschreiten von Zivilisation beschreibt und teilweise erst möglich macht. Entsprechend wichtig sind Symbole seit jeher auch in der Geschäftswelt. Dresscodes, Bürozuschnitte, Sitzordnungen, Dienstwagenausstattung – früher dienten Symbole vor allem dazu, Macht sichtbar zu machen. Auch in der durchdigitalisierten, postmateriellen Zeit bleibt Symbolik Ausdruck und Unterfütterung von Realität – bloß haben sich die Symbole und ihre Kontexte verändert: An die Stelle der protzigen Machtdemonstration tritt schalkhaftes Understatement.
Kai Diekmann und die Mutter aller Digitalsymbolik
Als sich Kai Diekmann und Christoph Keese im Jahr 2013 für einige Monate auf Silicon-Valley-Expedition begaben, mit dem Ziel, in der Wiege der digitalen Welt Inspiration für die Transformation ihres angestaubten Stammhauses zu finden, da entstand eine völlig neue Gattung von Symbolik: die Symbolik der digitalen Transformation. Diekmann, einst glatt rasiert und pomadenfrisiert, inszenierte sich plötzlich mit Rauschebart und Zottelmähne, wurde zum hornbebrillten Gesicht eines neuen Axel Springers, hochgejazzt zum Vordenker von Digitalisierung Made in Germany. Der Rest ist Geschichte: Axel Springer steht seither exemplarisch für eine rundum gelungene digitale Transformation und generiert heute 84 Prozent seines Konzerngewinns über digitale Kanäle. Klar ist: Der öffentlichkeitswirksam inszenierte Stunt von Diekmann und Keese hat die Ästhetik und Symbolik der digitalen Transformation entscheidend geprägt. Klar ist aber auch: Die Valley-Expedition hatte einen ökonomisch vernachlässigbaren Einfluss auf die Transformation Springers. Dass daraus eine Erfolgsgeschichte wurde, hatte einen anderen Grund: Der radikalen Symbolik folgte ein ebenso radikaler Umbau des gesamten Konzerns. Die Symbolik fungierte als gezielter Verstärker einer Realität im Wandel, nicht bloß als Fassadenanstrich für ein morsches Gebälk. Was bei Springer also vortrefflich gelang, daran scheitern viele Konzerne in den letzten Jahren: Veränderungssymbolik und tatsächliche Veränderung zusammenzubringen, ja die passende, individuelle Symbolik für den eigenen Veränderungsweg zu finden.
Die Realität: Zwischen Digitalvorstand und hauptamtlichem Barista
Die Reise ins Valley ist nur eines unter vielen Symbolen, die sich inzwischen rund um die digitale Transformation der Konzernwelt etabliert haben: Duz-Kultur, gelockerte oder gänzlich abgeschaffte Kleiderordnungen, Großraumbüros, Innovation Hubs in Berlin-Kreuzberg, Vorstandsposten für Irgendwas-mit-Digitalisierung, ein hauptamtlicher Barista und natürlich Bio-Obst in der Teeküche – die Symbolisierung von Veränderungsprozessen ist landauf, landab so abgegriffen wie vorhersehbar. Würde man für all diese Symbole, mit denen die Konzernwelt beinahe krampfhaft kenntlich machen will, dass sie verstanden hat, noch ein Metasymbol suchen, dann wäre es wohl der weiße Sneaker, der inzwischen zum Insignium des modernen CEO geworden ist. Strahlten in alten Zeiten Brioni-Anzug und Berluti-Schuhwerk patriarchale Machtfülle aus, so sind die weißen Sneakers dieser Tage das Symbol der modernen Führungskraft, ein Schuh als Botschaft: „Ich bin wie ihr: dynamisch, flexibel, hip“.
An vielen dieser Dinge ist nicht so viel falsch, manches mag man als gesamtgesellschaftlichen Fortschritt gutheißen, gegen Bio-Obst und freie Kleiderwahl ist nichts einzuwenden, doch taugen all diese mühsam replizierten, genau gleichen Praktiken und plumpen Symbole eben genau nicht als das, was Symbolik leisten könnte und müsste: Ihr bemühter, inflationär-aktionistischer Gebrauch atmet vielmehr genau jene Verunsicherung, die nicht wenige der Weltmarktführer von heute spüren, wenn sie in der Ferne die Konturen dessen erkennen, was da kommt: Ein Marktwandel von epochaler Qualität, der althergebrachte Gewissheiten über Wert und Wertschöpfung von Grunde auf in Frage stellt. Und weil keiner so recht weiß, wie man darauf antworten soll, schaut man eben zunächst links und rechts bei den Nachbarn.
Große Veränderungen brauchen starke Symbole
Dabei bräuchte es gerade für die vor uns liegenden Brüche und Umbrüche starke Symbole, die Halt geben, Richtung weisen und möglichst vielen als Projektionsfläche dienen. Die kommenden Dekaden werden jedes Geschäftsmodell, das heute noch Abermillionen abwirft, von Grunde auf in Frage stellen. Einschneidende Veränderungen von Organisationen wie auch Individuen sind unausweichlich – diese Veränderungen in klare, griffige Symbolik zu übersetzen, ist eine entscheidende Führungsaufgabe. Genau hier lauert das Problem, aber auch eine Chance: Symbolik ist idealerweise ein Destillat aus Vision, Mission, Werten und Strategie, eine maximale Verdichtung eines komplexen Entwicklungsprozesses, und nicht bloß eine hastig in der kleinen Pause abgeschriebene Hausaufgabe. Dort, wo die immer gleichen Symbole zirkulieren, da darf man zumindest einmal kritisch nachfragen, wie ausgereift die dahinterliegenden Ideen für die Zukunft der Organisation aussehen.
Was gute Symbolik leisten kann und muss
Klar ist: Gute Symbolik ist erfolgskritisch für jeden Veränderungsprozess. Gute Symbolik verstärkt die Realität. Gute Symbolik schafft es, Komplexität maximal zu reduzieren und doch bei der Wahrheit zu bleiben. Gute Symbolik überfordert eine Organisation nicht und setzt doch Reizpunkte, die die Weiterentwicklung forcieren. Gute Symbolik macht einen real erfahrbaren Veränderungsprozess zugespitzt sichtbar. Gute Symbolik ist so einzigartig wie möglich und so anschlussfähig wie nötig. Gute Symbolik ist keine Kopie. Gute Symbolik ist Ausdruck von Strategie. Gute Symbolik ist harte Arbeit.
Dominik Kaufmann ist Gründer und Geschäftsführer von KAUFMANN / LANGHANS. Er arbeitete zuletzt als Projektleiter für die Strategie- und Organisationsberatung undconsorten und beriet dort DAX- und TecDAX-Unternehmen bei den Themen Transformation, Agilisierung und Vertrieb. Zuvor war er als Market Manager für die Daimler AG tätig. Dominik ist Alumnus der Studienstiftung und Mitglied bei Mensa e.V..