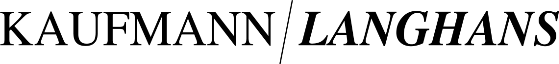CEOs als Portfoliomanager:innen
Über das Verständnis von Innovation als Wette auf die Zukunft

Trotz massiver Investitionen von Zeit und Geld bleibt Innovation in vielen Unternehmen ein extrem herausforderndes Unterfangen. Warum ist es so schwer, wirklich innovativ zu sein? Die Gründe dafür liegen nicht bloß in der ausbleibenden Umsetzung guter Ideen, sondern vielmehr in einem grundfalschen Verständnis von Innovationsmanagement.
Innovation ist das neue Schwarz. Alle gieren nach dem Stoff, aus dem die Zukunft gemacht wird. Der Aufbau einer Innovationskultur ist eine der dringendsten Herausforderungen für die zukünftige Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen (zwei Drittel der Unternehmen sehen Innovation als eine der obersten Prioritäten an). Die Realität ist indes vielerorts eine andere: CEOs scheitern mit ihrer Innovationsagenda, Innovationslaboren geht die Puste aus und nach dem zwanzigsten ergebnislosen Design-Thinking-Workshop macht sich Ernüchterung breit. Eine zentrale Ursache für diese Misere: Viel zu viele Unternehmen gehen das Thema Innovation mit einem Management-Verständnis an, das auf Risikovermeidung und Effizienz, statt auf Risikobewältigung und Exploration setzt. Doch wie lassen sich Innovationen unter den extrem unsicheren und höchst volatilen Umweltbedingungen des digitalen Zeitalters erfolgreich managen? Ein Blick auf die Branche der Wagniskapitalgeber könnte hier Abhilfe verschaffen.
Venture-Capital-Fonds verstehen Innovation nüchtern als das, was sie eigentlich bedeutet: Eine langfristige Wette auf eine ungewisse Zukunft. Und weil die Zukunft eben ungewiss ist, schließen sie nicht nur eine einzige Wette ab, sondern einen prall gefüllten Wettschein mit lauter kleinen vielversprechenden Wetten. So managen VC-Fonds ein Portfolio von potentiellen Innovationen, von denen eine beträchtliche Zahl scheitern wird. Doch dieses Scheitern ist von Beginn an eingepreist und wird durch die wenigen, aber durchschlagenden Erfolgsgeschichten letztlich ökonomisch überkompensiert.
Unterschiedliche Innovationsarten müssen unterschiedlich gemanaged werden
Überträgt man dieses Innovationsverständnis auf Konzerne wie Mittelständler, wird deutlich, wie wenig die zumeist auf Risikovermeidung und Effizienz ausgelegte Management-Praxis für das Vorantreiben von Innovationen geeignet ist. Die Konsequenz: CEOs müssen die inkrementelle Innovation im Kerngeschäft und die Erschließung neuer Geschäftsfelder durch disruptive oder radikale Innovationen nicht nur voneinander entkoppeln, sondern diese beiden Portfoliobereiche auch grundverschieden führen. Im Kerngeschäft und bei dessen inkrementeller Verbesserung greift auch künftig ein konventionelles, auf Effizienzgewinne und Wachstum getrimmtes Management, um Renditeziele zu erreichen und nicht zuletzt Investitionskapital für bahnbrechende Innovationen zu erwirtschaften. Bei disruptiven oder radikalen Innovationen hingegen geht es vor allem um die Exploration neuer Geschäftsfelder. Und genau wie Venture Capitalists nicht a priori das eine Unicorn auswählen und ihre Investition entsprechend allokieren können, können auch CEOs in Ermangelung einer Glaskugel nicht vorab die eine Knallerinnovation auswählen, ohne auf diesem Weg in eine Reihe von anfangs vielversprechenden Ideen zu investieren, die sich jedoch als Rohrkrepierer entpuppen. Anders als im Kerngeschäft, wo der Gewinn das kurzfristige Ziel ist, darf er im Innovationsgeschäft nicht das Ziel sein. Vielmehr ist der kalkulierte Verlust durch das Platzieren einer Vielzahl von zunächst kleineren Wetten – von denen ein beträchtlicher Teil scheitern wird – die Investitionsbedingung für die Innovationen von morgen.
Gleichwohl: Die Investitionsbereitschaft allein ist noch lange kein Garant für Investitionserfolg. Sie ist im Sinne des Portfolio-Ansatzes bloß die notwendige Bedingung. Erst durch die Verknüpfung der Unternehmensstrategie mit einer Innovationsstrategie, einer daraus resultierenden Investmentstrategie sowie durch eine innovationsfördernde Kultur entstehen die hinreichenden Bedingungen für Innovation.
Innovation braucht eine auf die Unternehmensziele abgestimmte Strategie
Eine Innovationsstrategie muss in Abstimmung mit der Unternehmensstrategie Antworten auf drei essentielle Fragen liefern: Wie schafft Innovation einen Mehrwert für meine potenziellen Kunden? Wie kann das Unternehmen einen Anteil an diesem Mehrwert gewinnen? Und schließlich: Welche Arten von Innovationen wollen wir eigentlich langfristig verfolgen: Inkrementelle, disruptive oder radikale Innovationen? Die mancherorts vertretene Annahme, dass disruptive Innovationen inkrementellen Innovationen per se überlegen sind, ist dabei eine sehr vereinfachte Sichtweise. Vielmehr kommt es darauf an, die Innovationsstrategie aus der Unternehmensstrategie abzuleiten und dabei zugleich die spezifischen Umfeldbedingungen des Unternehmens zu berücksichtigen, wenngleich die Innovationsgeschwindigkeit zunehmend branchenübergreifend konvergiert. Langfristig gilt entsprechend: Will ein Unternehmen auf Dauer erfolgreich sein, wird es unweigerlich in alle drei Innovationsarten investieren müssen.
Radikale Innovation bringt langfristig die höchste Rendite – und das höchste Risiko
Die Gretchenfrage, vor der Unternehmenslenker:innen stehen: Wie groß sollen die einzelnen Wettscheine auf die jeweiligen Innovationsarten sein? Eine allgemeingültige Antwort kann dieser Artikel schwerlich liefern – allein schon deshalb, weil es viele, individuelle intervenierende Variablen gibt, wie etwa die Industrie, in der das Unternehmen tätig ist. Nichtsdestotrotz gibt die Praxis Hinweise darauf, dass erfolgreiche Unternehmen durchschnittlich 70 Prozent ihrer Investitionen in Kerngschäftsinnovationen stecken, 20 Prozent in die Exploration angrenzender Innovationen und nur 10 Prozent in radikale Innovationen. Interessanterweise entspricht die langfristige Rendite in etwa dem umgekehrten Verhältnis: Der Löwenanteil wird mit radikalen Innovationen verdient. Bei der Frage der genauen Ressourcenallokation zeigt sich, wie essentiell ein Alignment der Unternehmensstrategie mit der Innovationsstrategie ist: Denn je nach Ergebnis dieses Alignments kann ein höheres Risikoprofil (d. h. größere Investitionen in radikale Innovationen) sinnvoll sein. In jedem Fall aber hilft ein solches Vorgehen, sich als Unternehmen darüber im Klaren zu sein, welche Ausgaben man in welchem Umfang – und vor allem mit welcher Absicht – tätigt.
Eine Innovationskultur ist extrem voraussetzungsreich
Doch auch für die beste Innovations- und Investmentstrategie gilt: Culture eats strategy for breakfast. Will sagen: Die beste Innovations- und Investmentstrategie nützt nichts, wenn dafür kein fruchtbarer Boden bereitet wird. Natürlich wissen alle, dass Innovation mit einer Fehlerkultur, Kollaboration und Psychological Safety einhergeht. Doch das ist nur die eine Seite der Medaille: Die Seite, die Spaß macht. Auf der anderen Seite steht: Dass eine Fehlerkultur ein hohes Leistungsniveau voraussetzt. Dass ein kollaborativer Ansatz maximale Verantwortungsübernahme voraussetzt. Und dass Psychological Safety mit radikaler Ehrlichkeit einhergeht. Diese Gegensätze zeigen, dass eine die Innovation fördernde Kultur nicht zwangsläufig für jede:n etwas ist. Sie ist mitunter belastend, extrem voraussetzungsreich und keineswegs Ringelpiez mit Anfassen. Sie erfordert ein ganz anderes Mind- und Skillset der Mitarbeiter:innen.
Dies alles macht deutlich: Der Innovationsprozess ist ein extrem komplexes Unterfangen, weil er im Grunde genommen hochgradig widersprüchlich ist. Das Paradoxon: Innovation setzt die Koexistenz von Sicherheits- und Risikobestreben voraus. In dieser Gratwanderung liegt zugleich die große Chance für die deutsche Industrie: Nicht nur, weil sie derzeit noch die finanziellen Mittel hat, um auch in radikale Innovationen zu investieren, sondern auch, weil viele der Unternehmen die nötige Weitsicht mitbringen, um zu verstehen, was Innovation wirklich bedeutet: Eine langfristige Wette auf eine ungewisse Zukunft.
Maximilian Van Poele ist Consultant bei KAUFMANN / LANGHANS. Zuvor arbeitete er bei der Agentur hypr und entwickelte dort u. a. die strategische Positionierung für die Innovationsplattform eines mittelständischen Familienunternehmens. Maximilian hat Communication Management studiert und wurde 2019 vom PR Report als Young Professional des Jahres ausgezeichnet.