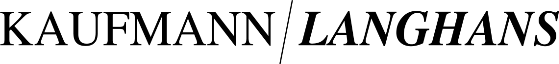Warum wir in Zukunft mehr statt weniger Vernetzung brauchen
Alles wird anders? Hoffentlich nicht

Geschockt von Corona ziehen sich Unternehmen wie Staaten reflexartig in ihr eigenes Schneckenhaus zurück. Es spukt der Geist der Rückabwicklung unserer vernetzten Welt – ein fataler Irrglaube. Denn wer Resilienz, Innovationen und Wertschöpfung in einer immer komplexeren Welt will, der braucht mehr Vernetzung – und nicht weniger.
In der Krise ist sich jeder selbst der Nächste: Zurückgezogen warten wir im eigenen Schneckenhaus bis das Unwetter vorüberzieht und hoffen, dass es uns nicht den Boden unter den Füßen wegspült. Hochprofitable Konzerne setzen Mietzahlungen aus, Unternehmen überstrapazieren die Zahlungsziele ihrer Zulieferer, Nationalstaaten bunkern medizinisches Equipment lieber auf Reserve statt es an Verbündete in Not zu exportieren. Ein bisschen Solidaritäts-PR, Masken nähen, doch mehr lässt diese Krise scheinbar nicht zu. Die vernetzte Welt scheint ausgeträumt, am Ende; am Horizont viel kleines Karo, am Wegesrand viele, die es schon immer gewusst haben: Alles wird anders. Die große Rückbesinnung auf sich selbst. Es grassiert der regressive Geist im Gewand der Utopie. Mag in der gegenwärtigen Katharsis manch gedanklicher Schnellschuss und Kurzschluss verständlich sein, so ist die Hoffnung auf eine Rückabwicklung der vernetzten Welt jedoch ein riesengroßer Fehler.
Vom Ich zum Netzwerk: Wir brauchen einen grundlegenden Perspektivwechsel
Die Erfahrung der Verwundbarkeit, die weite Teile der Gesellschaft und Wirtschaft gegenwärtig machen, bietet uns die Chance auf einen grundlegenden Perspektivwechsel: Wir müssen weg vom Ich-zentrierten Denken und Handeln und hin zu einem Netzwerk-zentrierten Selbstverständnis. Der zentrale Gegenstand eines solchen Denkens ist nicht mehr die eigene Unternehmung, nicht mehr die eigene Organisation, sondern das Netzwerk, das größere Ganze, in dem wir agieren. Ein Netzwerk, das bewusst tradierte Muster durchbricht, über die eigene Branche hinausgeht, aus Wettbewerbern Partner macht. Wer Resilienz, Innovation und Wertschöpfung in einer immer weiter digitalisierten Welt will, der muss diesen Wandel im Selbstverständnis zulassen, ihn aktiv forcieren, der muss neue Demut an die Stelle alter Selbstherrlichkeit setzen, der muss sich als Bestandteil eines größeren Ganzen verstehen statt als Nabel der (alten) Welt.
Vernetzung ist die Grundlage für Resilienz, Innovation und Wertschöpfung
Eine der wichtigsten Lehren dieser Pandemie lautet: Wir müssen ein Stück Effizienz aufgeben und es gegen Resilienz tauschen. Doch wie genau soll das eigentlich funktionieren? Netzwerke sind bei der Operationalisierung dieser abstrakten wie richtigen Idee von elementarer Bedeutung, da sie anders als Ketten eben nicht bloß so stark wie ihr schwächstes Glied sind, sondern per dezentraler Organisation und dekonzentrierter Macht schwerer zu verwunden sind, ergo resilienter. Wer Resilienz will, der braucht mehr und stärkere Vernetzung, nicht weniger.
Auch im globalen Wettlauf um Innovationen bleiben Unternehmen (und Standorte) nur wettbewerbsfähig, wenn sie selbst die Scheuklappen absetzen und zum Zweck ihrer eigenen Weiterentwicklung und Selbstdisruption alte Branchengrenzen und Wettbewerbslinien aufbrechen. Denn klar ist: Die grundlegende Verschiebung von Wert und Wertschöpfung, die de facto vor keiner Branche Halt macht, wird durch die Folgen der Corona-Krise letztlich nur weiter beschleunigt. Das Zauberwort heißt aber auch hier Vernetzung, denn Innovationsfähigkeit im digitalen Zeitalter lässt sich im Angesicht des technologisch induzierten Innovationsdrucks kaum mehr anders als in branchen-, fach- und länderübergreifenden Netzwerken hinreichend schnell und wettbewerbsfähig organisieren. Die Öffnung von Unternehmensgrenzen zum Zweck von Innovationen ist mithin überlebensnotwendig, um einer Disruption von außen zuvorzukommen.
Doch Netzwerke sind nicht nur eine Form, um Wertschöpfung zu organisieren, sondern wegen ihrer Beschaffenheit und systemischen Eigenschaften auch selbst Wertträger und -treiber. Der Grund dafür: Mit steigender Teilnehmerzahl eines Netzwerks steigt der individuelle Nutzen für jeden Teilnehmer – und somit der Wert des Netzwerks. Dieser Mechanismus ist die Grundlage der Plattformökonomie. Und wie sich die Wertschöpfung global weg vom Produkt und hin zum Service entwickelt, gewinnen Netzwerke nicht nur als Organisationsform, sondern allen voran auch als Abwicklungs- und Vertriebssysteme der digitalen Dienstleistungsgesellschaft an Bedeutung. Software as a Service, Mobility as a Service, Everything as a Service – der Service ist die zentrale Wertschöpfungsform in der postindustriellen Epoche und das Netzwerk ist das ihm zugrundeliegende Organisations- und Strukturmuster.
Welchen Platz hat mein Unternehmen in welchem Netzwerk?
Um das eigene Unternehmen innerhalb eines Netzwerks zu verorten – und gegebenenfalls zu repositionieren –, gilt es zunächst, die Wertschöpfung nicht mehr primär aus Unternehmensbrille zu betrachten, sondern sie unternehmensübergreifend und ganzheitlich vom Kundennutzen ausgehend zu analysieren. Erst so lässt sich verstehen, an welchen Stellen und mit welchen Verbindungen im Heute und Morgen wirklich Wert erzeugt wird, welchen Beitrag das eigene Unternehmen leistet und welche Rolle es einnimmt: Netzwerk-Provider stellen die Infrastruktur und Technologie bereit und setzen formelle Standards für das Netzwerk. Netzwerk-Enabler hingegen verbinden die Akteure untereinander, etwa als Logistikdienstleister. Netzwerk-Producer schließlich erzeugen die Produkte bzw. erbringen die Dienstleistungen innerhalb eines Netzwerks.
Der Perspektivwechsel hin zur Netzwerk-zentrierten Organisation manifestiert sich allen voran darin, dass der Frage »Wie profitiere ich vom Netzwerk?« die Frage »Wie profitiert das Netzwerk von mir« vorangestellt wird. Netzwerke sind das Resultat des kumulierten Engagements der Vielen in Form von Zeit, Geld und Fähigkeiten. Wer stabile, resiliente Netzwerke will, muss entsprechend in Vorleistung gehen – mit materiellen Investitionen, geteiltem Wissen, aber auch mit einem Vertrauensvorschuss und dem Mut, langfristigen Erfolg über kurzfristigen Profit zu stellen.
Der Wandel vom selbstbezogenen zum offenen und vernetzten Unternehmen hat letztlich auch Einfluss auf die Beschaffenheit der eigenen Organisation. Klar ist: Die Organisation der Zukunft sieht signifikant anders aus als das, was wir gegenwärtig unter einem Unternehmen verstehen. Ihre Prozesse, Strukturen, Fähigkeiten und Kultur wird sie mittelfristig so optimieren, dass sie möglichst erfolgreich in einem Netzwerk agieren kann – und auf diesem Weg entwickelt sie sich langfristig zu ihrem eigenen Kontext oder: Zu einem Netzwerk.
Unsere Vernetztheit ist Kennzeichen von Fortschritt
Von der Kleinstaaterei zu Staatenverbünden, von eindimensionalen Lieferketten hin zu multidimensionalen Produktionsnetzwerken, von Einzelkämpfern hin zu einflussreichen zivilgesellschaftlichen Akteuren – Netzwerke sind Kennzeichen unseres zivilisatorischen wie ökonomischen Fortschritts. Unsere Vernetzung im Sinne einer verlässlichen und funktionalen Verbindung entlang von geteilten Interessen hat seit jeher eine essentielle Bedeutung für unsere Wirtschaft, für unsere Gesellschaft, für unser gesamtes Zusammenleben. Der Siegeszug der Informations- und Kommunikationstechnologie hat diese Entwicklung hin zur vernetzten Welt in den letzten Dekaden maßgeblich vorangetrieben. Die Corona-Pandemie und die aus ihr erwachsenden Krisen bedeuten fraglos einen Stresstest für die Qualität unserer Netzwerke. Sie zeigt uns, welche Netzwerke bloß blumige Sonntagsreden liefern und welche uns wirklich verlässliches Miteinander bieten. Sie legt die Schwächen unserer Netzwerke schonungslos offen, manche Brüchigkeit, aber auch dysfunktionale Machtkonzentrationen. Doch eines stellt sie eben nicht in Frage: das Netzwerk an sich, die Vernetzung als zentrale Erfolgsbedingung der Spätmoderne – im Gegenteil. Der Fehlschluss solcher Argumentationen lautet: »Weniger Vernetzung gleich mehr Resilienz«. Das mag schlüssig klingen, ist aber grundfalsch. In einer gestärkten und verbesserten Netzwerkstruktur liegen vielmehr die zentralen Antworten auf die Herausforderungen, vor denen große und kleine Unternehmen, aber auch allerlei andere Organisationen und letztlich wir als Gesellschaft gegenwärtig stehen: Mehr Resilienz gewährleisten, mehr Innovationen erzeugen, nachhaltige Wertschöpfung ermöglichen.
Dominik Kaufmann ist Gründer und Geschäftsführer von KAUFMANN / LANGHANS. Er arbeitete zuletzt als Projektleiter für die Strategie- und Organisationsberatung undconsorten und beriet dort DAX- und TecDAX-Unternehmen bei den Themen Transformation, Agilisierung und Vertrieb. Zuvor war er als Market Manager für die Daimler AG tätig. Dominik ist Alumnus der Studienstiftung und Mitglied bei Mensa e.V..